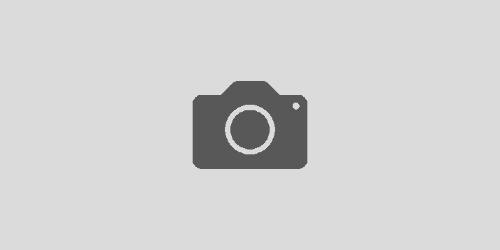Leitfrageninterview mit Rolliman

Alles rund um Inklusion…
Mein Leitfrageninterview vom 05.12.2017 mit Herrn X, den ich im Folgenden aufgrund der Anonymisierungspflicht der Daten mit dem Nickname Rolliman einführen werde, beschäftigte sich mit dem Thema Inklusion und dem Themenbereich „Vielfalt“ und bezog sich auf die Forschungsfrage, inwiefern sich der Umgang mit Inklusionsschülern in deutschen Schulen damals, vor circa 30 Jahren, als die Inklusionsdiskussion noch in ihren Anfängen steckte, sich von der Situation der Inklusionsschüler von heute unterscheidet.
Zunächst jedoch einige wichtige Angaben zu meinem Interviewpartner Rolliman: er ist 47 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Aachen und ist seit seiner Geburt aufgrund seiner spastischen Lähmung auf einen Rollstuhl angewiesen. Ab dem Jahre 1984 besuchte er eine Realschule im Kölner Umkreis. Diese Schule war allerdings zunächst keine „Inklusionsschule“, sondern eine Realschule für nicht behinderte Schüler. Aufgrund von Platzmangel jedoch suchte eine Behindertenschule aus der gleichen Umgebung eine Einrichtung und so kam die Idee auf, dass man beide Schulen zusammen legen könnte, da die Nicht-Behinderten Realschule überschüssige Klassenräume anzubieten hatte. Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen als Inklusionsschüler und seiner Teilnahme an diversen Podiumsdiskussionen zum Thema Inklusion im Allgemeinen habe ich mich für ein Interview mit Rolliman entschieden.

Zu Beginn des Interviews wurde ein Einverständniserklärung des Interviewten eingeholt. Die Atmosphäre im Allgemeinen ließ sich als entspannt beschreiben, der Interviewte fühlte sich wohl und reagierte mit Offenheit auf die ihm gestellten Fragen. Im Nachfolgenden soll darauf hingewiesen werden, dass dieses Interview speziell auf die Erfassung subjektiver Eindrücke abzielte und die Fragen relativ offen gestellt worden sind. Das Interview liegt mir sowohl als Sprachaufnahme als auch als transkribierte Version vor.
Meine erste Leitfrage ,,Was bedeutet für Sie Inklusion?“ zielte darauf ab, zunächst eine grobe Definition und Vorstellungen zu dem Begriff der Inklusion von dem Befragten zu erhalten. Grundlegend bedeute dieser Begriff für ihn das gleichwertige Eingebunden sein in die Gesellschaft als Behinderter, sprich, dass man nicht zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten differenziert und beide gleiche Chancen besitzen, am Alltag teilzunehmen. In diesem Fall bezog auf er sich im Wesentlichen auf das Ausüben alltäglicher Tätigkeiten, wie das Einkaufen im Supermarkt, ausgehen, in einem Restaurant essen gehen, ins Kino gehen, etc. Für ihn scheitere jedoch die Inklusion von behinderten Menschen jedoch gerade an diesen alltäglichen Dingen. So nannte er zum Beispiel, dass ein spontanes Ausgehen mit Freunden für ihn als Rollstuhlfahrer nahezu unmöglich sei und es einer zeitaufwendigen Planung und Vorbereitung bedürfe. Demzufolge muss man sich als Rollstuhlfahrer oder als gehandicapte Person zunächst einmal die Frage stellen, ob man überhaupt in die gewünschte Einrichtung hineinkommt, diese behindertengerecht ausgestattet ist, über eine Behindertentoilette verfügt, Aufzüge vorhanden sind etc. Auch das selbstständige Einkaufen oder das Ziehen eines Fahrtickets am Automaten ohne Hilfeleistung durch Fremde oder Begleitpersonen stellt für manchen Behinderten eine nahezu unmögliche Herausforderung da, so seien beispielsweise die Kühltruhen für ein Rollstuhlfahrer aufgrund der Höhe nicht erreichbar, oder das Abwiegen von diversen Waren wegen des Höhenunterschiedes nicht möglich.
Inklusion betrifft beziehungsweise begegnet uns gerade bei diesen alltäglichen Tätigkeiten, die wir für selbstverständlich halten, die allerdings für einen behinderten Menschen oftmals nicht gerade unproblematisch sind. Der Begriff bezieht sich nicht nur auf den schulischen Bereich, sondern lässt sich auf viele weitere Bereiche aufteilen, beginnend im Kindergarten, in der Grundschule und in der weiterführenden Schule, im Berufsalltag, bei Freizeitaktivitäten, im privaten und familiären Bereich etc.
Meine zweite Leitfrage lautete wie folgt: ,,Wie würden Sie, als ehemaliger Inklusionsschüler, im Allgemeinen die Situation innerhalb ihrer alten Schulklasse beschreiben und haben Sie irgendwelche Vorstellungen oder Anmerkungen zur aktuellen Inklusionsdebatte?“ Zum Verständnis erläuterte Rolliman zunächst sein altes Schulmodell, den erstmaligen Versuch der Zusammenlegung zweier Schulen, einer Behindertenrealschule und einer Nicht-Behinderten Realschule, in dieser Umgebung. Man kann dieses Modell also als eine Art Vorläufermodell für eine „Inklusionsschule“ betrachten. Die Zusammenlegung beider Schulen war unter anderem auch möglich, da die benötigte Einrichtung, wie medizinische Räume, Aufzüge bereits gegeben war. Lediglich drei Behindertentoiletten wurden nachträglich errichtet.
Der Unterricht fand zu Beginn in getrennten Unterrichtsklassen statt, in der Pause jedoch konnten alle Schüler miteinander in Kontakt treten und spielen. Erstere Überlegungen, den Unterricht gemischt zu gestalten, ergaben sich bei der Wahl des 1.Differenzierungsfach, wo die SuS zwischen Informatik, Latein oder Französisch auswählen konnten. Aufgrund guter Ergebnisse, führte das Kollegium anschließend die Überlegungen weiter, sodass das auch bei der Wahl des 2.Differenzierungsfaches, einer Fremdsprache oder der Wahl zwischen Biologie, Chemie und Informatik, gemischter Unterricht stattfand. Die Lernatmosphäre beschrieb Rolliman als locker und entspannt, die SuS halfen sich gegenseitig, so half beispielsweise ein Nicht-Behinderter Schüler einem behinderten Schüler beim Abschreiben und Mitschreiben von Unterrichtsinhalten und der behinderte Schüler wiederum gab einem Nicht-Behinderten Schüler Nachhilfe in einem Fach, dass er besser beherrschte.
Zum Einsatz von Zivildienstleistenden, Pädagogen oder sonstigem Fachpersonal kam es nur in seltenen Fällen, beispielsweise bei der medizinischen Versorgung während der Pausen oder als „Schreibhilfe“ bei Klausuren. Den SuS wurde bei der Kontaktaufnahme und der Lösung von etwaigen Problemen untereinander relativ viel Freiraum gelassen, sodass sie sich auch wirklich „begegnen“ konnten. Aufgrund merklicher Erfolge beschloss man dann auch, ab der Sek. II die Klassen komplett gemischt zu unterrichten.

Zu der aktuellen Inklusionsdebatte äußerte sich Rolliman, dass Vorurteile und das Voreingenommen sein gegenüber Behinderten oftmals eine Auferlegung durch die Gesellschaft und durch Erwachsene sei, da Kinder bzw. SuS normalerweise ihren Spielkameraden nicht aufgrund von Religionszugehörigkeit, Herkunft, Hautfarbe, Handicap oder Geschlecht auswählen und beurteilen. Vielmehr galt es der Gesellschaft, speziell den Eltern, den Lehrpersonen, den SuS und Anderen die Angst vor dem Fremden und Unbekannten zu nehmen. Inklusion könne nur gelingen, wenn man sich unvoreingenommen begegnet, Vorurteile ablegt und sich erst ein mal „kennenlernt“.
Hinzu käme das Problem, inwiefern man speziell den Sportunterricht gestalte, ob man diesen komplett wegfallen lassen sollte oder Möglichkeiten ausprobiert, behinderte SuS auch dort aktiv einzubringen. Diesbezüglich nannte der Interviewte ein Beispiel aus dem Behindertensport, wo es sogenannte „Schadensklassen“ gibt, die gewährleisten, dass sich Behinderte aus gleichen Schadensklassen begegnen und gegeneinander antreten, um den Wettkampf fairer zu gestalten. Ob eine ganzheitliche Fairness möglich ist, sei fraglich, allerdings wäre dies ein Ansatz, um diese Problematik anzugehen. Ebenso sollte Nicht-Behinderten SuS verständlich gemacht werden, dass wenn ein Behinderter Schüler z.B. 30 Minuten aufgrund seines Nachteilsausgleichs länger schreiben darf, nicht gleichzeitig heißt, dass dieser eine erhebliche Bevorzugung erhalte.
Ein weiterer Schritt hin zur Inklusion bedeute auch das Ablegen von traditionellen Vorstellungen zum Thema Schule und Schulform, aus dem sogenannten „Schubladendenken“ auszubrechen, „mit der Zeit zu gehen“, auf die individuellen Bedürfnisse und Persönlichkeiten jedes Einzelnen einzugehen und sich für neue Ideen und Vorschläge zu öffnen. So hinge beispielsweise der Schulerfolg auch direkt mit dem Begriff der Motivation zusammen, das heißt, inwiefern kann ich SuS, Eltern, Lehrkräfte, Pädagogen etc. dazu motivieren, ein solches Projekt wie die Inklusionsschule anzugehen? Welche Chancen und Möglichkeiten würden sich ergeben? Inwiefern kann man ein neues Gruppengefühl integrieren und die Zusammenarbeit von Nicht-Behinderten-SuS und Behinderten-SuS fördern? Gibt es bereits eventuelle Vorläufermodelle, die meine Idee von der Inklusion unterstützen? Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen?
Auch erwähnte Rolliman, dass von der Politik oftmals Schulgesetze erlassen würden, die keine bestimmten Vorgaben zur Umsetzung beinhalten, sodass die Schulen desöftern auf sich allein gestellt sind. Auch hier bedarf es einer engeren Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Politik und Schuleinrichtung.